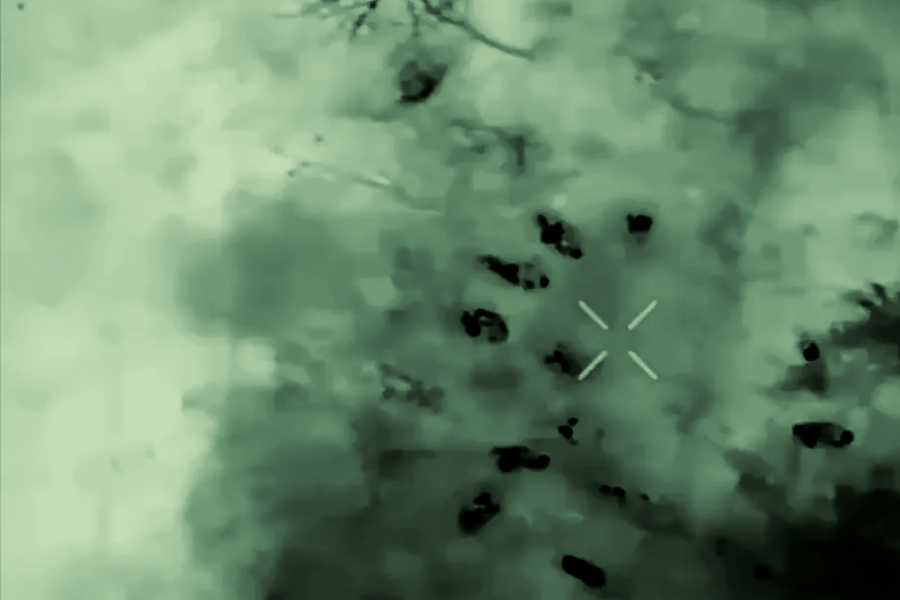Just ein Monat nach dem Release von ajour-mag.ch veröffentlichte die anarchistische Zeitung Dissonanz eine geharnischte Kritik an unserem Onlinemagazin. Endlich haben wir Zeit gefunden, auf den Artikel zu antworten und hoffen, damit auch dem Bedürfnis nach Debatte zu entsprechen.
Wer die Dissonanz kennt, weiss um ihre spitze Feder. Kaum ein Organ der Herrschaft, das wegen dieser anarchistischen Zeitung aus Zürich nicht eine Schmach erlitten hätte, aber ebenso kaum eine linke Strömung, die nicht unter die erbarmungslosen Räder der dissonanten Kritik gekommen wäre. Der in diesem Blatt gewählte Ton ist oft ziemlich gehässig. Das mag legitim sein, ist dem Lesevergnügen aber nicht gerade zuträglich. Dieser Stil entspricht einem Duktus, der innerhalb der insurrektionalistischen Szene mit einer erstaunlichen Beständigkeit gehegt und gepflegt wird. Verbale Vorlagen finden sich etwa in Klassikern wie dem Büchlein mit dem klingenden Titel «In offener Feindschaft mit dem Bestehenden, seinen Verteidigern und seinen falschen Kritikern» oder auch im Text «Zehn Dolchstösse gegen die Politik» (die übrigens beide durchaus einmal gelesen werden können).
Nun hat die spitze Feder der Dissonanz unser liebes ajour magazin getroffen, ein noch zartes journalistisches Geschöpf, das erst jüngst das grelle Licht des Internets erblickte und nun im unerbittlichen Kampf der revolutionären Presselandschaft zu bestehen hat. Gehört das ajour nun zu diesen «falschen Kritikern des Bestehenden» oder lässt es die Finger von den überall lauernden und verführerischen Ketzereien? Wird unser Magazin nun gar auf die «offene Feindschaft» gewisser Anarchist*innen stossen, etwa gar die Propagandist*innen der Tat zu fürchten haben?
Freundlicherweise adelt die Dissonanz unser Magazin gleich zu Beginn als «Gemisch zusammengewürfelter Meinungen» und als «bloss marginale Erscheinung». Darauf folgt eine Blattkritik, die sich wie eine Aufforderung zum Duell liest – bereits wird von uns ein «eigener anarchistischer Diskurs» verlangt. Zugleich handelt es sich auch um eine Gesinnungsprüfung. So mahnt die Dissonanz mit erhobenem Zeigefinger, dass wir keinerlei «Bezugshemmung zum Revolutionären Aufbau» hätten. Und sowieso könne man sich «eines kleinen Verdachts nicht erwehren». Hört, hört! Doch der Verdacht wird schnell zum Urteil, denn wir seien «offensichtlich unfähig Fisch und Vogel zu unterscheiden». Ja, sapperlot! Das wollen wir nun doch nicht auf uns sitzen lassen, liebe Genoss*innen Gefährten.
Wir verstehen gut, dass die Ungewissheit über die Urheberschaft eines politischen Magazins und insbesondere über deren ideologischen Vorzeichen zu einer auffordernden Neugierde reizen kann. Gerne versuchen wir also ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, beschränken uns dabei aber auf wesentliche Punkte. Schliesslich sind die spöttischen Bemerkungen doch so zahlreich, dass wir hier zu weit ausholen müssten. So haben wir zum Beispiel wenig Lust, darüber zu debattieren, ob unser digitales Erscheinungsformat «Beziehungen abkapselt» und – angeblich ganz im Gegensatz zu gedruckten Schriften wie der Dissonanz – nicht zur gesellschaftlichen «Realität» gehört.
Der Staat ist kein Verbündeter
Beginnen wir also beim Antifaschismus. Es stimmt, dass wir «irgendwelchen verlorenen Neonazikäuzen» nachspürten (Bernhard Schaub und Raphael Rotzer, der wegen unserer Recherche seinen Gewerkschaftsvorsitz abtreten musste), ohne in diese Artikel eine umfassende Analyse des Antifaschismus eingebaut zu haben. Hier eine solche einzufordern halten wir für absurd, denn nach dieser Logik müsste jedem Bericht noch das eigene politische Programm untergejubelt werden. Einen solchen Journalismus überlassen wir gerne anderen.
Wir dachten eigentlich, dass es sich in Zeiten wie diesen erübrigen würde, über die Notwendigkeit des Antifaschismus zu streiten. Doch weit gefehlt! Aus der wohligen Nestwärme der Kuhschweiz lässt sich die Dissonanz dazu hinreissen, über den Kampf gegen das «grössere Übel» zu schnöden, weil dadurch stets «die soziale Revolution beiseitegeschoben» werde. Richtet man diese Kritik an ehemalige Kämpfer*innen gegen faschistische Diktaturen in Lateinamerika und Europa oder an KZ-Überlebende, wird schnell klar, wie überheblich diese Haltung ist. Zur Erinnerung: Die Pressefreiheit etwa, von der auch die Dissonanz profitiert, wurde einst erkämpft. Es dürfte sich also durchaus lohnen, dieses Recht in der ach so teuflischen Demokratie zu verteidigen. Nicht nur Genoss*innen in der Türkei können aktuell ein Lied davon singen. Diese eigentlich banale Erkenntnis macht uns aber noch nicht zu Anhänger*innen der demokratischen Herrschaftsform oder des Staates, wie das die Dissonanz glaubt. Gerade weil wir uns weder auf Parteien noch auf den Staat verlassen können, muss die Bekämpfung von Faschist*innen, also der Antifaschismus, von uns selbst geleistet werden. Anarchist*innen werden noch lange nicht zu Steigbügelhaltern des Staatssozialismus, bloss weil sie sich an strömungsübergreifenden antifaschistischen Kämpfen beteiligen. Die Dissonanz rückt uns sogar in die Nähe von Stalin, der angeblich auch «gegen den Staat» gewesen sei.
Es bleibt jedoch nicht bei der Unterstellung, dass wir verkappte Unterstützer*innen autoritärer Revolutionskonzepte seien. Die Dissonanz versteht jede Form des Antifaschismus unterschiedslos als «interklassistische Falle» und unternimmt den ziemlich infamen Versuch, allen Antifaschist*innen eine ideologische Nähe zum bürgerlichen Staat und der demokratisch Herrschenden zu unterstellen. Schliesslich würden Nazis «auch dem Bundesrat nicht passen». Dürfen wir also die Hausdurchsuchungen und Gerichtsverfahren, die Haftstrafen und Bussen gegen Antifaschist*innen ganz einfach als Zeichen der Anerkennung und der demokratisch-antifaschistischen Freundschaft verstehen? Weder ist der Staat Verbündeter im Kampf gegen rechte Gewalt, noch machen die Behörden militante Rechte unschädlich. Das zeigt sowohl das Beispiel des NSU als auch die faschistoide Entwicklung in verschiedenen Staaten. Revolutionärer Antifaschismus ist eine Praxis des Selbstschutzes. Wenn wir Nazis und reaktionären Kräften den öffentlichen Raum streitig machen, schränken wir ihre Handlungsmacht ein und erweitern zugleich die unsrige. Capito?
Wir sind Klasse!
Als nächstes ist da die Sache mit uns Arbeiter*innen und den wundersamen Maschinen, welche uns angeblich restlos ersetzen und somit unsere Klasse ganz automatisch aufheben würden. Dissonanz, bitte melden! Wo sind diese Kommunisierungsmaschinen bloss zu kriegen? Gebt her diese automatisierten Paradiesbeschleuniger! Mal im Ernst: Die Annahme, dass eine Klassenposition oder nur schon die Verwendung des Klassenbegriffs automatisch eine leninistische oder sonst wie autoritäre Revolutionstheorie zur Folge hat, läuft ins Leere. Wir setzen auf klassenkämpferische, kollektive und selbstorganisierte Formen des Widerstandes. Wir haben nichts am Hut mit parteiförmiger Organisierung oder der Übernahme der Macht im Staat. Wir kritisieren einen Klassenbegriff, der Herrschaftsverhältnisse übersieht und dem eine deterministische Geschichtsauffassung zugrunde liegt. Doch will das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Wir leben augenscheinlich in einer Klassengesellschaft. Wenn die Dissonanz dies nicht erkennen kann, will sie es nicht erkennen. Dieser Verklärung sitzen Neoliberale und manche Individualist*innen gleichermassen auf.
Von einer Klassenanalyse abzusehen, führt zu einem doppelten Manko. Erstens fehlt eine Handhabe, um die Verheerungen der kapitalistischen Totalität zu erfassen. Keinem Herrschaftsverhältnis kann gebührend begegnet werden, wenn nicht auch der Klassendimension nachgegangen wird, die sich im jeweiligen Dominanzverhältnis manifestiert. Zweitens ist die Arbeitswerttheorie ein nützliches Werkzeug zum Verständnis der Gegner*innenschaft zwischen Proletarisierten und Kapitalist*innen. Ohne Klassenbegriff kann der vielfältige, kollektive und individuelle Widerstand proletarisierter Menschen nicht als solcher erkannt und mitgetragen werden.
Wenn wir die Dissonanz richtig lesen, propagiert sie einen primär individuellen Kampf gegen die «Herrschaft». Zudem lehnt sie eine Klassenposition ab, weil daraus automatisch eine autoritäre Revolutionstheorie hervorgehe. Eine solche vereinfachende Kritik macht unzählige anarchistische und dissidente kommunistische Strömungen entweder unsichtbar oder wirft sie zu Unrecht mit dem Stalinismus in den gleichen Topf. Dahinter steht der Versuch, sowohl anarchistische Positionen mit Klassenanalyse, als auch antiautoritäre kommunistische Strömungen als Wegbereiterinnen des Staatssozialismus darzustellen. Werte Freund*innen, es ist doch keineswegs so, dass der Gebrauch des Klassenbegriffs eine*n automatisch zu einer*m Anhänger*in eines autoritären Marxismus macht – das wusste auch Bakunin, der Marx› Kapital als Erster ins Russische zu übersetzen begann. Wir haben den Eindruck, die Dissonanz fürchtet sich vor allem, was nicht ihrem eigenen Dunstkreis entsprungen ist. Wer sich nicht der puristischen Herangehensweise dieser Zeitung verschreibt, wird in dieser Logik selbst Teil des Problems. Nun lassen wir aber ab von diesem Gezänk und schreiten weiter zum animalischen Hauptbestandteil der Dissonanz-Kritik.
Ideologische Reinheitsansprüche? Ohne uns.
Kommen wir zum Vorwurf, Fisch und Vogel nicht unterscheiden zu können. Wenn also die Fische den «Autoritarismus» verkörpern und die Vögel den «Antiautoritarismus», so sind wir uns nicht ganz sicher, wozu eigentlich die Dissonanz zu zählen ist. Einerseits fliegt die Dissonanz frei herum wie ein Vogel und leistet mitunter wertvolle Beiträge gegen allerlei linke Mythen und Politikantentum. Andererseits fischelt es doch ziemlich unangenehm, wenn Leute mit vermeintlich gelehrten Phrasen und pseudopoetischem Geschwätz ein einziges und reines Ideal des Anarchismus predigen. Ganz zu schweigen von der fast schon religiösen Anmassung, den Anarchismus für sich gepachtet zu haben und ihn davor bewahren zu müssen, dass wir und andere ihn «billig in einem ideologischen Gemisch verdünnen.» Anarchismus ist aber kein Opium, das man strecken und damit seine Wirkung schwächen kann. Vielmehr sind der Anarchismus wie auch der Kommunismus in soziale Bewegungen und in gesellschaftliches Bewusstsein eingebettet, die beide immer vielfältig, widersprüchlich und in ständiger Veränderung begriffen sind. Wir meinen auch, dass der Horizont oft unnötig verengt wird, wenn Kampfgenoss*innen vorschnell als Fische abgetan werden. Es dürfte ja zur Genüge bekannt sein, dass weder die kommunistische noch die anarchistische Bewegung jemals einheitlich waren, sondern dass beide über vielfältige Traditionen verfügen und dass es sogar so weitreichende Überschneidungen gibt, dass eine Begriffsklauberei überflüssig wird. Ohnehin ändern sich Begriffsbedeutungen ständig und unterscheiden sich je nach Epoche und lokalem Kontext beträchtlich.
Das Redaktionskollektiv des ajour magazins besteht aus Aktivist*innen verschiedener Spektren der anarchistischen und antiautoritären kommunistischen Bewegung und legt sich nicht auf das Dogma einer einzelnen Strömung fest. Dafür sind wir der Überzeugung, mit Debatte und Kritik, aber auch mit Austausch und Respekt, der Sache einen Dienst zu erweisen. Wie unserem Selbstverständnis zu entnehmen ist, wollen wir die «marginalisierten und diskreditierten Perspektiven des Widerstands» einnehmen, den Fokus «auf die Momente der Auflehnung» richten und unter den Menschen sein, «die sich solidarisch zusammenschliessen und sich organisieren, die zum Unrecht nicht schweigen, sondern auf die Strasse gehen, die streiken und besetzen». Es stimmt also, dass wir keinen «eigenen anarchistischen Diskurs» propagieren. Wir suchen die revolutionäre Perspektive nicht in Reinheitsgraden, sondern im Handgemenge von Kritik und Praxis. Die verschiedenen revolutionären Bewegungen, Richtungen und Traditionen hatten alle ihre Stärken und Schwächen. Oft erwiesen sich bestimmte Kooperationen als fruchtbar und in Zeiten des unmittelbaren Kampfes und des kollektiven Aufbruchs verschwanden alte Trennlinien und neue Identitäten wurden erschaffen. Das ist noch heute so, und das wissen alle, die im sozialen Gemenge stehen und dort kämpfen. Geben wir uns also nicht damit zufrieden, wie ein einsamer Wolf – umgeben bloss von seinesgleichen – gegen angeblich Abweichlerische zu heulen, wo diese doch Gefährt*innen sein könnten!
Titelbild: Parée. Howling at the Moon