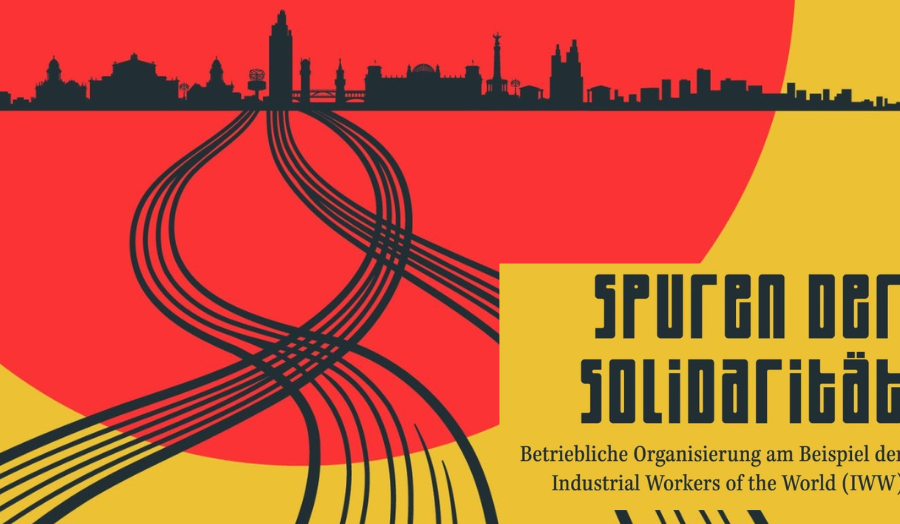Nach einer Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise kommt es in Ecuador seit dem Wochenende zu heftigen und breit abgestützten Sozialprotesten. Diverse Territorien sind von Aufständischen besetzt und gewisse Zentren der Macht sind belagert. Mittlerweile ist die Regierung aus der Hauptstadt geflüchtet. Das macht klar: Der «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» ist endgültig Geschichte. Die Bewegung aber muss sich die Frage stellen, wie sie über das ewige Auswechseln der Regierungen hinauskommen und ihre systemische Integration verhindern kann.
Von Mariana Lautréamont. Vor wenigen Tagen kündigte der ecuadorianische Präsident Lenin Moreno an, die Subventionen für Diesel und Benzin per 3. Oktober abzuschaffen. Letzten Donnerstag ist deshalb der Dieselpreis von 1,03 auf 2,27 Dollar und der Benzinpreis von 1,85 auf 2,30 Dollar pro Gallone gestiegen. Die Reaktion der Prekarisierten folgte auf dem Fuss: Schon am selben Tag kam es zu landesweiten Protesten, Strassenblockaden mit brennenden Barrikaden, Streiks im Transportsektor, Plünderungen und Ausschreitungen. Die heftigsten Konfrontationen ereigneten sich in der Hauptstadt Quito. Auch in der Küstenstadt Guayaquil kam es zu massiven Plünderungen. Die Proteste hielten übers ganze Wochenende an. Alleine an den ersten zwei Tagen wurden über 230 Kundgebungen in 20 Provinzen gezählt.

Die Medien und die Regierung versuchen die sozialen Proteste zu delegitimieren, indem sie sie als orchestrierte Destabilisierung gewalttätiger Vandalen betiteln oder berichten, dass hauptsächlich gutsituierte Leute aus dem Transportsektor beteiligt seien, die Angst um ihre Privilegien hätten. Dies wird der Situation nicht gerecht: Neben Bus-, Taxi- und LKW-Fahrer*innen sind Gewerkschaften aus verschiedenen Sektoren, indigene Gruppierungen, Schüler*innen, Landarbeiter*innen und ausserparlamentarische und studentische Organisationen ebenfalls auf den Strassen. Die Proteste haben sich im ganzen Land verbreitet, die staatlichen Massnahmen werden als das wahrgenommen was sie sind: Ein Angriff auf die Lebensumstände der Prekarisierten.

Die Sparmassnahme hat unmittelbare Auswirkungen auf vor allem ärmere und prekarisierte Schichten der Lohnabhängigen. Viele Menschen sind auf den Individualverkehr angewiesen, um ihre Arbeitskraft verkaufen zu können. Diejenigen, die sich kein Auto leisten können, müssen mit Fahrpreiserhöhungen rechnen (in Guayaquil kostet eine Busfahrt neu 0,40 USD anstatt 0,30 USD). Auch der Warentransport wird teurer, was sich z.B. in einer Verteuerung der Lebensmitteln niederschlagen wird. «Steigen die Benzinpreise, dann wird das ganze Leben teurer» besagt ein populäres Sprichwort. Denn all die Lebensmittel, die in die Städte und Dörfer transportiert werden, sind auf dieselbetriebene Lastwagen angewiesen.
Das Ende des Sozialismus des 21. Jahrhunderts
Die Streichung der Treibstoffsubventionen ist nur eine erste Massnahme eines umfassenden Sparkurses der Regierung Moreno und ist Ausdruck einer umfassenden Krise. Die Zeit des populistischen «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» mit seinen sozialen Programmen und der Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur ist schon seit Längerem vorbei. Vor allem in seinen ersten vier Jahren, von 2007 bis 2011, schien sich die Lage der ärmeren Schichten tatsächlich zu verbessern. Dem damaligen Präsidenten Rafael Correa spielten die hohen Erdölpreise in die Hände. Er konnte die Staatsschulden senken, durch staatliche Investitionen die Wirtschaft ankurbeln und ein Teil der staatlichen Einnahmen den Armen zukommen lassen, die von der Politik in der Regel komplett vergessen wurden. Insgesamt wurden während Correas Amtszeit die Staatsausgaben verdreifacht, was u.a. durch chinesische Kredite in Milliardenhöhe ermöglicht wurde. Doch der Erdölboom währte nicht lange. Die Ölpreise sanken ab 2011 und erreichten 2014 einen Tiefpunkt. Mit dem Preisverfall stieg die Staatsverschuldung kontinuierlich an: Betrug sie im Jahr 2010 noch 17,7% des BIP, waren es im Jahr 2018 bereits 46,1%. Nach seiner Abwahl im Jahr 2017 hinterliess Correa seinem ehemaligen Vize und Nachfolger Lenin Moreno eine zerrüttete Wirtschaft und einen hochverschuldeten Staat: Ein Hilfegesuch an den Internationalen Währungsfonds (IWF) erschien als unausweichlich.
Als Zeichen seiner Kooperationsbereitschaft mit dem IWF und dessen Auflagen, ordnete Moreno Anfang 2019 die Entlassung von Zehntausenden Angestellten im öffentlichen Dienst an. Davon waren bisher fast 12’000 Menschen betroffen. Allein im Gesundheitssektor wurden am 1. März dieses Jahres ca. 3000 Leute freigestellt. Nichtsdestotrotz kündigte die Regierung letzte Woche weitere 10’000 Entlassungen an. Bei solchen Massenentlassungen mit dem Ziel die Staatsausgaben zu senken, handelt es sich um eine typische Forderung des IWF. Während sie in Ecuador für eine Welle der Empörung sorgte, genehmigte der IWF dem ecuadorianischen Staat am 11. März 2019 einen Kredit von 4.2 Milliarden US-Dollar, verteilt über die nächsten drei Jahre. Damit sollte die Staatsverschuldung Ecuadors gesenkt werden. Wie üblich ist der IWF-Kredit an Forderungen gekoppelt. Und wie schon in Spanien, Griechenland, Argentinien oder Brasilien treffen die geforderten Massnahmen auch in Ecuador diejenigen Teile der Bevölkerung, die ohnehin schon zu den Verlierer*innen dieses Wirtschaftssystems gehören. So sollen u.a. «Arbeitsmarktreformen» (z.B. Lockerung des Kündigungsschutzes, weniger Ferien und eine Lohnkürzung von 20% für Angestellte im öffentlichem Dienst), mehr Temporärstellen mit geringer Arbeitssicherheit, Senkung der Einfuhrzölle für Investitions- und Konsumgüter, Rentenreformen, Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, Steuerreformen zu Gunsten der Unternehmen und eben die Streichung der Subventionen für Benzin und Diesel durchgesetzt werden.
Grassierender Autoritarismus
Die Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise ist also nur die erste Massnahme eines umfassenden Sparkurses samt «Reformen» zu Lasten der Proletarisierten. Und obwohl schon dieser erste Schritt heftige Proteste auslöste, zeigt sich die Regierung wild entschlossen, die IWF-Auflagen durchzuprügeln: Bereits am ersten Tag der landesweiten Unruhen rief Moreno einen 60-tägigen Ausnahmezustand aus. Dies ermöglicht ihm massive Einschränkungen der Bewegungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Ab dem Freitag, 4. Oktober marschierte in verschiedenen Städten die Armee auf. Da am Donnerstag einige Demonstrant*innen den Präsidentenpalast zu stürmen versuchten, hat das Militär nun die ganze Umgebung rund um den Palast abgeriegelt. Die Armee versuchet in verschiedenen Städten, die Protestierenden zurückzudrängen und die zahllosen Strassenblockaden zu räumen. Die Repressionsorgane des Staates gehen brutal gegen die Demonstrant*innen vor. Unzählige Videos in den sozialen Medien dokumentieren Polizeigewalt in verschiedenen Städten Ecuadors, verprügelte Demonstrant*innen und Journalist*innen sind an der Tagesordnung. In Quito verlor ein Demonstrant ein Auge, in Cayambe wurden zwei junge Männer schwer verletzt. Protestierende werden mit Farbpatronen beschossen, um sie im Nachhinein zu verhaften und die Polizisten fahren in Quito auf Motorrädern durch die Strassen und knüppeln alle nieder, die ihnen im Weg stehen. Wer sie zu filmen versucht, muss ebenfalls mit Schlägen oder einem kaputten Handy rechnen.

Insgesamt wurden zwischen dem 3. und 4. Oktober über 350 Menschen verhaftet. Präsident Moreno hält derweilen an seinem Kurs fest und verkündet, die Fahrzeuge zu beschlagnahmen, die zurzeit für Strassenblockaden verwendet würden. Ein Dialog führe er nur mit Menschen, die bestimmte «ethische und moralische Prinzipien» einhielten. In einer Pressekonferenz am Freitag posaunte er: «Hört mir gut zu, ich werde die Massnahmen nicht zurückziehen, damit das klar ist: Die Subventionen bleiben gestrichen, die Zeit der Faulenzerei ist vorbei».
Die soziale Wut ist schwer zu bändigen
In Ecuador können die Protestierenden auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit flächendeckenden Unruhen zurückgreifen. Zwischen 1997 und 2005 wurden drei Präsidenten mit ähnlichen Methoden gestürzt, wie sie die Protestierenden heute anwenden. Jede dieser Bewegungen kam ohne Anführer*innen aus und war unabhängig von politischen Parteien, auch wenn bekannte Politiker*innen versuchten, sich einzumischen und die Proteste für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren. Die Wucht, mit der die ecuadorianische Bevölkerung regelmässig auf die Strasse geht, hat schon jede Menge Politiker*innen ins Schwitzen gebracht. Erinnern wir uns an den ehemaligen Präsidenten Lucio Gutierrez, der im Jahr 2005 angesichts der heftigen Auseinandersetzungen rund um den Präsidentenpalast mit einem Militärhubschrauber ausgeflogen werden musste. Sein Plan, mit dem Hubschrauber direkt auf dem Flughafen zu landen, in ein Flugzeug zu steigen und ins Ausland zu flüchten, ging nicht auf. Demonstrant*innen stürmten den Flughafen und besetzten die Startbahn. Gutierrez versteckte sich daraufhin in der brasilianischen Botschaft, ehe er als Polizist verkleidet aus dem Land flüchtete.

Für Ecuador sind die Ausmasse der Proteste also nicht Neues, auch wenn es seit Jahren nicht mehr zu so grossen Mobilisierungen kam wie in den letzten Tagen. Die Leute wissen ganz genau, wie sie eine Regierung ins Wanken bringen können. Das zeigt sich auch in der schnellen Antwort auf die Sparmassnahmen seitens der Prekarisierten: Am gleichen Tag, an dem die Massnahmen angekündigt wurden, kam es zu Demonstrationen. Und wenige Tage später hatten sich die Proteste im ganzen Land verbreitet. Dass die Zahl der Teilnehmer*innen im Laufe der Tage zunahm, stimmt zuversichtlich. Genauso wie die anhaltenden Proteste und Strassenblockaden über das ganze Wochenende. Auch wenn die Regierung versucht, ihre Nervosität zu kaschieren und behauptet, die Situation hätte sich am Freitag weitgehend beruhigt, beweist die Strasse das Gegenteil: Seither hat sich der Konflikt massiv zugespitzt. Offenbar sind verschiedene Ölfelder von indigenen Gruppen besetzt und stillgelegt worden, repräsentative Sitze der Regierung sind teils durch Protestierende belagert. Weitere Streiks und Kundgebungen sind bereits angekündigt. Und verschiedene indigene Gruppierungen wollen am 8. Oktober in einem Riesenmarsch in die Hauptstadt Quito vordringen. Auf den 9. Oktober wird ausserdem zu einem Generalstreik aufgerufen.
Diese Intensivierung und Verlängerung des Kampfes ist begründet. Denn die kollektive Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es nicht genügt, ein paar wenige Tage das Land zu blockieren. Vielmehr müssen die Mobilisierungen über einen längeren Zeitraum anhalten, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Ob die Leute die Kraft und Entschlossenheit dazu haben, wird sich zeigen.
Die wiederkehrende Macht der Integration
Auch wenn sich die Wut zur Zeit in Windeseile verbreitert und die Proteste noch zunehmen könnten, bleibt eine grosse Herausforderung: Denn zur Erfahrung der letzten Jahrzehnte gehört auch, dass die Bewegungen nach dem Sturz des jeweiligen Präsidenten nicht weiter wusste. Zu wenig ausgeprägt war die Infragestellung der kapitalistischen Warengesellschaft und die damit verwobenen Herrschaftsformen. So reichte es letztlich bloss für eine Auswechslung des politischen Personals. Zwar wurden Sparmassnahmen teilweise zurückgezogen und Errungenschaften verteidigt oder gar neue erkämpft. Aber im Grossen und Ganzen ging die alte Scheisse wieder von vorne los. Ehe sich die Bewegung dessen bewusst wurde, war sie bereits in das politische Spektakel integriert. Es ist ein wiederkehrendes Problem vieler sozialer Bewegungen: Die Kritik am Bestehenden wird rein unter dem Vorzeichen der Negativität geübt, man weiss wogegen, aber nicht wofür man kämpft. Die Abwendung der Sparmassnahmen ist ein legitimes Anliegen, aber müsste eher als Ausgangs- anstatt als Endpunkt verstanden werden: Erst in der Negation der Negation kann das Positive hervortreten. Das heisst, etwas das über das Gegebene hinausweist, anstatt es, zwar unter ein wenig besseren Vorzeichen, zu zementieren. Es wird sich zeigen wie schnell und wie einfach bzw. wie schwer sich dieses Mal die soziale Wut integrieren lässt. Bleibt zu hoffen, dass das kollektive Gedächtnis die vielen Erfahrungen, Fehler und Erkenntnisse der sozialen Kämpfe der letzten Jahrzehnte nicht vergessen hat. Und wenn der flüchtige Geist des Arbeiter*innenrats von Guayaquil von 1922 durch die Köpfe der Kämpfenden spuken sollte, dann wäre das sicher eine Bereicherung für die Bewegung. Nicht aus nostalgischen Gründen, sondern zwecks der Wiederentdeckung einer praktischen Kritik, die über das Bestehende hinausweist.